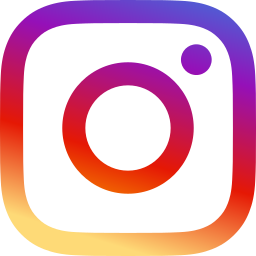11.09.2011
Vorsicht Studie!
Die Politik legitimiert ihre Entscheidungen gern durch Forschungsergebnisse. Warum es sich für den Bürger trotzdem lohnt, genau hinzuschauen, zeigt das Beispiel Familienförderung. Von Birgit Kelle und Maria Steuer
Im Zwei-Jahres-Rhythmus durchforstet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das statistische Material zum weltweiten Stand von Familie und Geburtenrate; Studien wie "Doing better for children" (2009) oder "Doing better for families" (2010) werden gern zur Begründung politischer Maßnahmen herangezogen und sind als wissenschaftlicher Gradmesser anerkannt. Maria Steuer und Birgit Kelle, beide in Familien- und Frauenverbänden aktiv und keine Anhängerinnen der aktuellen Familienpolitik, haben die jüngste Studie einer genaueren Prüfung unterzogen. Ergebnis: In Teilen widerspricht diese Studie von 2010 der von 2009 - allein deshalb, weil die Interessen von Frauen, Familien und Kindern nicht immer deckungsgleich sind. Fazit der Autorinnen: "Wie am Ende entschieden wird, ist nicht Wissenschaft, sondern Politik."
1. Ein einhelliges Ziel
Studie: In den OECD-Ländern sind im Durchschnitt knapp 60 Prozent der Frauen erwerbstätig. Wo immer die Frauenerwerbsquote bei diesem Wert oder darüber liegt, wachsen vergleichsweise wenige Kinder in Armut auf. Die OECD schließt daraus, dass der Kinderarmut, die oft eine versteckte Mütterarmut ist, am besten begegnet werden könne, wenn mehr Mütter arbeiteten.
Situation in Deutschland: Mit 65,2 Prozent liegt die stetig zunehmende Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland inzwischen über dem OECD-Durchschnitt und der des Vorbilds Frankreich (60 Prozent) - die Familienarmut aber steigt proportional, statt zu fallen. Gleichzeitig empfiehlt die Bundesanstalt für Arbeit ebenso wie eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die Frauenerwerbsquote weiter zu steigern, um so etwa zwei Millionen Fachkräfte zu gewinnen.
Schlussfolgerung: Jedenfalls in Deutschland funktioniert der Rückschluss nicht, dass Kinder in besseren ökonomischen Verhältnissen aufwachsen, wenn Mütter arbeiten. Viele von ihnen arbeiten auf ausdrücklichen Wunsch nur in Teilzeit (45,3 Prozent), das gilt auch für Norwegen (43,6 Prozent) und die Schweiz (56,5 Prozent), und wollen dies auch beibehalten oder sogar ausweiten, bestätigt die soeben erschienene Studie zu Müttern in Europa im Auftrag der EU-Kommission. Man muss sich also mehr einfallen lassen, um Kinderarmut zu bekämpfen. Der Paritätische Gesamtverband Berlin hat schon 2007 vorgerechnet, dass zehn Prozent mehr Kindergeld - also direkte finanzielle Zuweisungen - acht Prozent weniger Kinderarmut bedeuteten und damit etwa 120 000 Familien besser stellten.
2. Was hilft der Familie?
Studie: Die Ausgaben für Familienförderung liegen im OECD-Durchschnitt bei 2,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Deutschland investiert 2,8 Prozent in Familien; Frankreich, Dänemark und Island führen die Liste mit mehr als 3,5 Prozent an. Weil in diesen Ländern auch überproportional mehr Kinder geboren werden, empfiehlt die OECD, die Ausgaben für Familienförderung an diese Länder anzugleichen. Wörtlich heißt es: Viel hilft viel.
Situation in Deutschland: Laut Bundesregierung gibt Deutschland im Jahr etwa 184 Milliarden Euro für Familienförderung aus - das entspräche für das Jahr 2010 etwa sieben Prozent des BI P. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kam allerdings schon 2007 in einer Gegenrechnung auf Ausgaben von nur 38,6 Milliarden Euro, also 1,6 Prozent des BI P. Damit wäre Deutschland Schlusslicht in der OECD, und es wäre eine Erklärung dafür, warum die Familienpolitik nicht vorankommt. Die Abweichungen ergeben sich zum Teil daraus, dass die Behörden auch Leistungen einbeziehen, die nichts mit dem Vorhandensein von Kindern im Haushalt zu tun haben, wie etwa Witwenrenten oder die steuerliche Absetzbarkeit von Haushaltshilfen.
Schlussfolgerung: Jedes Land liefert individuelle Zahlen an die OECD und bezieht unterschiedliche Maßnahmen ein. Deshalb ist es nahezu unmöglich, die Ausgaben der einzelnen Länder direkt zu vergleichen. Auf Anfrage bestätigt selbst die OECD, dass die vorliegenden Zahlen nur bedingt vergleichbar seien und für einige Länder überhaupt keine Zahlen vorlägen. Sie taugen also nicht für Rückschlüsse, stattdessen müssen einzelne Maßnahmen miteinander verglichen werden.
3. Bargeld oder Kindergartenplatz?
Studie: In den meisten europäischen Ländern werden Familien vor allem durch direkte Zuwendungen wie Kinder- und Elterngeld oder Einmalzahlungen nach der Geburt gefördert. Und fast überall ist nachzuweisen, dass die Kinderarmut sinkt, wenn die direkten Zahlungen steigen. Dennoch rät die OECD, in hochwertige frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung zu investieren und direkte Familienleistungen zu kürzen. Damit widerspricht sie ihrer eigenen Studie aus dem Jahr 2009, in der sie direkte Leistungen als Mittel gegen Familienarmut forderte.
Situation in Deutschland: Die Bundesregierung folgt der neuen OECD-Empfehlung und investiert vor allem in Krippen und Kindergärten. Mit direkten Zahlungen tut sie sich dagegen schwer, wie die Diskussion rund um die sogenannten Bildungsgutscheine gezeigt hat. Auch die Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach Steuererleichterungen für Familien wurde bisher nicht umgesetzt.
Schlussfolgerung: Was tatsächlich hilft, um Familien zu fördern, vermag auch die OECD nicht zu sagen. So haben Frankreich, Schweden und Luxemburg zwar ähnlich hohe Geburtenraten, die Hilfen aber sind unterschiedlich: Schweden gewährt kaum Steuervorteile, bietet aber eine gute Infrastruktur, Luxemburg setzt vor allem auf direkte Familienförderung, und Frankreich kombiniert beide Ansätze; dort leben Familien ab dem dritten Kind nahezu steuerfrei, gleichzeitig wird auch in Infrastruktur investiert. Frankreich zeigt damit anschaulich, dass in der Familienförderung nicht alles gleichzeitig geht: Die Steuerfreiheit ab dem dritten Kind stützt zwar die Geburtenrate, senkt aber die Erwerbsquote bei Müttern. Man muss sich also entscheiden.
4. Wie fördert man richtig?
Studie: Je früher in die Bildung und Erziehung von Kindern investiert wird, desto höher ist die Rendite, heißt es aus der OECD. Worauf dieser Zusammenhang beruht, sagt die Studie nicht, empfiehlt aber eine Neuausrichtung der Bildungsausgaben zugunsten der ersten Lebensjahre; stattdessen könne die Hochschulbildung zunehmend privat finanziert werden. Die OECD definiert drei Altersgruppen: 0 bis 5 Jahre, 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre.
Situation in Deutschland: Deutschland investiert in allen drei Altersgruppen mehr als der OECD-Durchschnitt und liegt auch bei der Verteilung auf der Linie der Empfehlung. So gibt Deutschland für die Kleinsten fast 30 Prozent der gesamten Bildungsaufwendungen aus und liegt damit nur knapp hinter Schweden und Dänemark und somit über dem OECD-Durchschnitt von 25 Prozent. Auch bei den Ausgaben für die Sechs- bis Elfjährigen liegt Deutschland mit etwa 40 Prozent leicht über dem OECD-Durchschnitt.
Schlussfolgerung: Statistisch steht Deutschland damit gut da, dennoch werden im Moment Anstrengungen unternommen, vor allem die Kleinstkinder noch stärker zu fördern. Die sogenannten U3-Plätze sollen massiv ausgebaut werden, wobei sich die Befürworter auf die Empfehlungen der Studie berufen - die eine weitere Unterteilung der ersten Gruppe allerdings gar nicht kennt; die OECD-Empfehlung könnte ebenso gut für die Förderung von Vorschulkindern gelten. Sollte die Frühstförderung dem Ziel dienen, junge Frauen zur Familiengründung zu ermuntern, sind Zweifel angebracht: Die USA, mit zwölf Prozent der Ausgaben für die bis zu Fünfjährigen eines der Schlusslichter im OECD-Vergleich, haben mit 2,1 Prozent eine extrem hohe Geburtenrate.
5. Die Tücken der Statistik
Studie: Die Geburtenrate liegt in Deutschland mit 1,36 Kindern pro Frau unter dem OECD-Durchschnitt von 1,7. Aufgrund der ihr vorliegenden Daten zieht die OECD den Schluss, dass höhere Geldleistungen zumindest vorübergehend zu mehr Kindern führen könnten - Erfolg versprechender aber scheinen ihr Investitionen in Kinderbetreuungsdienste zu sein. Vorbild sind die nordischen Länder, in denen es ein durchgehendes Angebot von Unterstützungsleistungen in Form von bezahltem Elternurlaub mit Arbeitsplatzgarantie, Zuschüssen zur frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung sowie Betreuung außerhalb der Schulzeit bis zum Beginn der Sekundarschulzeit gibt.
Situation in Deutschland: Auch hierzulande gilt die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Schlüssel, um die Geburtenrate zu erhöhen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung will man gleich drei Ziele erreichen: mehr Geburten, eine höhere Frauenerwerbsquote und bessere Bildung der Kinder. Dagegen spricht, dass die Geburtenrate bei Frauen in Ein-Verdiener-Ehen in Westdeutschland auch heute noch bei mehr als zwei Kindern pro Frau liegt, ebenso in Frankreich. Arbeiten beide Partner Vollzeit, sinkt die Geburtenrate auf ein Kind pro Frau. In Schweden mit einer Frauenerwerbsquote von fast 76 Prozent scheinen sich dagegen die beiden Ziele - Frauenerwerbsquote und Geburtenrate - nicht gegenseitig zu behindern.
Schlussfolgerung: Wie sich Betreuungsangebote auf die Geburtenrate auswirken, kann empirisch weder für Deutschland noch weltweit belegt werden. Dies hat das deutsche Ifo-Institut schon im Jahr 2005 in seinem Forschungsbericht Nr. 26 festgestellt und eine "statistisch signifikante Wirkung" nur durch direkte Zuwendungen nachgewiesen. So ist in den neuen Bundesländern wegen der DDR-Geschichte die Dichte der Kita- und U3-Plätze extrem hoch, die Geburtenrate im bundesweiten Vergleich jedoch am niedrigsten; Bayern und Baden-Württemberg haben dagegen bei einem vergleichsweise kleinen Betreuungsangebot eine überdurchschnittlich hohe Geburtenrate. Auch international gibt die Statistik nichts her: So investieren die nordischen Länder viel Geld in den Ausbau der staatlichen Kinderbetreuung, in den USA dagegen sind Kindergarten und Betreuung teure Privatsache, nur im Jahr vor der Einschulung wird staatlich gefördert. Dennoch kommen alle diese Länder auf eine vergleichsweise hohe Geburtenrate von mehr als zwei Kindern pro Frau.
6. Eine ungehörte Warnung
Studie: Die OECD-Studie enthält auch eine Warnung: Werden Kinder zu früh (konkret: vor Vollendung des ersten Lebensjahres), zu viele Stunden und qualitativ unzureichend außerhalb der Familie betreut, könne das zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Zudem weist die Studie darauf hin, dass die wirtschaftlichen Lebensumstände größeren Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder haben als frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung oder die Erwerbstätigkeit der Mutter. Erst ab einem Alter von zwei Jahren seien die positiven Effekte einer qualitativ hochstehenden Betreuung in der Regel größer als die negativen; dies gelte besonders für Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern.
Situation in Deutschland: Die institutionelle Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr wird ausgebaut, um möglichst bald für mehr als 35 Prozent der unter Dreijährigen einen Krippenplatz bereitzustellen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse für bedürftige Familien mit Kindern werden trotz verfassungsgerichtlicher Aufforderung nicht verbessert.
Schlussfolgerung: Dass sich Deutschland für den Ausbau der institutionellen Betreuung von Kindern und gegen eine weitere finanzielle Unterstützung von Eltern entschieden hat, ist eine politische Entscheidung, die nicht mit den Empfehlungen der OECD-Studie zu begründen ist. Die Studie lässt keinen Zweifel, dass die wirtschaftlichen Umstände eines Kindes einen größeren Effekt auf sein Wohlbefinden und seine Bildung haben als frühkindliche Bildung. Genauso gut könnte die Studie als Begründung herangezogen werden, die direkten finanziellen Leistungen massiv auszuweiten.
---------------------
Maria Steuer, 52, Kinderärztin und Mutter von drei Kindern, arbeitet heute vorwiegend als Familientherapeutin und Schulärztin. Zudem ist sie im Vorstand der Stiftungsinitiative "Für Kinder" des kürzlich verstorbenen Familientherapeuten Wolfgang Bergmann.
Birgit Kelle, 36, Journalistin und Verlegerin, Mutter von vier Kindern, ist Vorsitzende der Initiative Frau 2000plus e. V. und Vorstandsmitglied des Brüsseler Dachverbands New Women For Europe (NWFE) mit Beraterstatus am EU-Parlament.